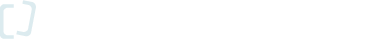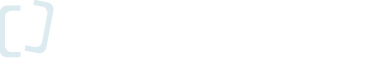Ziele
Die empirische Studie strebte erstmals österreichweit eine repräsentative Erfassung von unterschiedlichen Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen an. Der Fokus der Studie lag auf erwachsenen Personen, die in Institutionen leben, die zu erhebenden Gewalterfahrungen bezogen sich aber auf alle Lebensbereiche und -phasen. Die Erkenntnisse sollten zur Gewaltprävention und Unterstützung von gewaltbetroffenen Personen beitragen, Good Practice-Beispiele aufzeigen und Institutionen, die sich mit Gewaltvorfällen auseinanderzusetzen haben, als Hilfestellung dienen.
Die Forschungsperspektive orientierte sich an einem weiten Gewaltbegriff, der neben direkter und personaler Gewalt auch strukturelle Gewalt inkludiert, um die Vielfältigkeit und Komplexität der Gewalt- und Machtverhältnisse und deren Ursachen in den Blick zu bekommen.
Umsetzung
Um die komplexen Fragestellungen und Zielsetzungen der Studie ausreichend beantworten zu können, wurde ein triangulativer Forschungszugang gewählt, bei dem unterschiedliche quantitative und qualitative Methoden im Sinne einer wechselseitigen Ergänzung miteinander verschränkt wurden (Between-Method-Triangulation): Durchgeführt wurden standardisierte Befragungen von Menschen mit Behinderungen in ganz Österreich, vertiefende qualitative Interviews mit Menschen mit Behinderungen, ergänzende Fragebogenerhebungen im institutionellen Kontext, qualitative ExpertI*inneninterviews sowie zusammenfassende Good Practice-Analysen.
Im gesamten Forschungsprozess und bei der Ergebnisdarstellung wurde auf strenge Anonymität der befragten Personen und Institutionen geachtet. Zugleich kam vielfältigen Strategien zur Gewährleistung einer freiwilligen, sorgfältigen und behutsamen Datenerhebung besondere Bedeutung zu.
ProjektpartnerInnen:
Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (Projektleitung), Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, HAZISSA – Fachstelle für Prävention